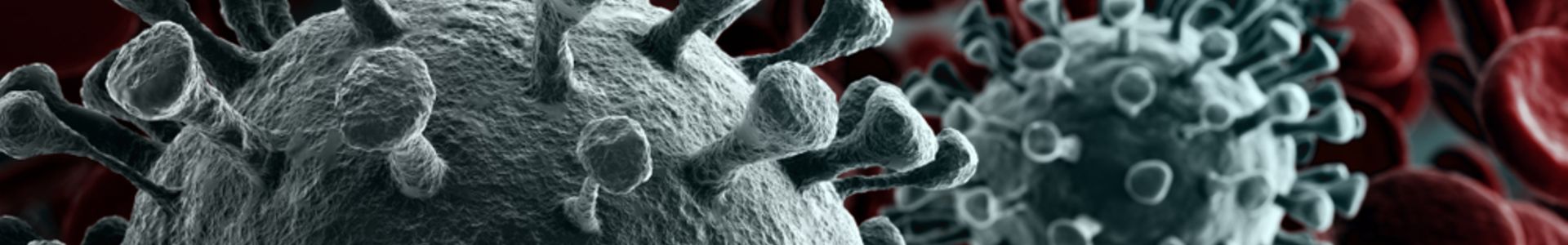Corona
Die Pharmaindustrie kämpft mit den Waffen der Forschung gegen das neue Coronavirus und der damit verbundenen Atemwegsinfektion Covid-19. Zugleich muss die Versorgung nicht nur von Corona-Patienten sondern auch von anderen Akutfällen, die Therapie von Chronikern und nicht zuletzt auch die Selbstmedikation gewährleistet werden oder erhalten bleiben. Dafür sind die mittelständischen Pharmaunternehmen essentiell wichtig.
FAQ COVID
An welchen Impfstoffen wird geforscht? Wann werden sie zugelassen? Wie sicher sind sie und wie könnten sie schnell verteilt werden? Diese und andere aktuelle Fragen beantworten wir in unserem FAQ. Eines ist sicher: Überall auf der Welt läuft die Corona-Forschung auf Hochtouren.
Bei der Suche nach Medikamenten, die die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit COVID-19 heilen oder lindern können, drücken Forscherinnen und Forscher weiterhin weltweit aufs Tempo. Mehr als 600 Arzneimittelkandidaten gegen COVID-19 werden derzeit erprobt.
Folgende Ansätze unter anderen lassen sich unterscheiden:
- Antivirale Medikamente: Dabei handelt es sich um zum Teil schon zugelassene Medikamente gegen andere Erkrankungen; es sind also Innovationen auf Basis bekannter Wirkstoffe, und der Vorgang wird allgemein als Repurposing, also Neuausrichtung oder Umwidmung, genannt. Ein bekannter Kandidat ist das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Remdesivir, das die Virusvermehrung im Zellinneren hemmt, und seit der Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) im Sommer 2020 zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt wird.
Weitere gute alte Bekannte sind zum Beispiel Colchicin, das bislang vor allem als Gicht-Medikament eingesetzt wird und Ivermectin, ein Antiparasitikum, das vor allem aus dem Einsatz gegen Fadenwürmer und Krätzmilben bekannt ist. Auch ein eigentlich gegen akutes Lungenversagen entwickeltes Arzneimittel mit dem kryptischen Namen „APN01“ gehört in diese Gruppe. Es bindet sich als „falscher Rezeptor“ an das Spike-Protein des Virus, so dass es nicht mehr am „richtigen Rezeptor“ an der menschlichen Zelle andocken kann. Dieses Arzneimittel wird derzeit in Studien erprobt und soll inhalativ verabreicht werden.
- Therapeutika in Tablettenform: Da Ärztinnen und Ärzten die bisher zugelassenen Arzneimittel nur intravenös und somit ambulant verabreichen können, ist die Entwicklung von oralen Therapeutika ein großer Fortschritt in der Therapie von COVID-19-Infektionen. Für Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gibt es zwei antivirale Arzneimittel in Tablettenform. Das Robert-Koch-Institut bietet eine Übersicht mit den verfügbaren COVID-19-Arzneimitteln (Stand 29. März 2022).
- Immunmodulatoren: Bei schweren Verläufen von COVID-19 ist es irgendwann nicht mehr das Virus selbst, sondern die überschießende Reaktion des eigenen Immunsystems, welche den Patienten zu schaffen macht. Dämpfende Immunmodulatoren regulieren die Immunüberreaktion herunter und werden auch gegen Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Multiple Sklerose eingesetzt.
Bei schwerstkranken COVID-19-Patienten konnte in einer Studie zum Beispiel der Wirkstoff Dexamethason, mit dem allergische Reaktionen, Asthma oder rheumatoide Arthritis behandelt werden, die Sterblichkeit deutlich senken. Auch hier handelt es sich um Innovationen auf Basis bewährter Wirkstoffe, also um sogenannte Schrittinnovationen.
- Monoklonale Antikörper: Diese werden bisher vor allem in der Krebstherapie und gegen Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Bei Krebs setzen sie sich auf die entarteten Zellen fest, blockieren deren schädliche Funktionen oder rufen körpereigene Immunstoffe zur Verstärkung.
Für den Kampf gegen COVID-19 erwiesen sich die monoklonalen Antikörper ebenfalls als sehr nützlich, bereits vier Präparate sind nun in der EU zugelassen. In der frühen Phase einer Infektion mit SARS-CoV-2 tragen sie zu einer deutlichen Verringerung der Viruslast bei.
Laut Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Zulassung von Biopharmazeutika zuständig ist, stehen mehrere Arzneimittel mit monoklonalen Antikörpern zur Behandlung von Covid-19 bereit. Welche monoklonalen Antikörper bereits in der EU zugelassen sind, finden Sie hier.
- Unterstützende Therapeutika: Neben dieser gut gefüllten Pipeline an möglichen Therapien gibt es eine Reihe weiterer Arzneimittel (neue oder umgewidmete) die Symptome von COVID-19 ebenfalls lindern und beispielsweise bei Lungenunterfunktionen von COVID-19-Patienten helfen könnten.
Damit ist die Liste der Therapeutika aber noch längst nicht erschöpft. Firmen und Forschungseinrichtungen testen zum Beispiel auch Nasensprays, die Viren schon in den oberen Atemwegen abfangen sollen.
- Als ungeeignet bei Covid-19 erwiesen sich: unter anderem das zu Beginn der Pandemie populär gewordene Hydroxychloroquin, das üblicherweise zur Malaria-Therapie eingesetzt wird, sowie das Gicht-Medikament Colchicin. Auch für das Antiparasitikum Ivermectin konnte keine Wirkung gegen COVID-19 festgestellt werden, im Gegenteil es wird vor einer Einnahme abgeraten, da aufgrund der notwendigen hohen Dosierung zur Erreichung eines antiviralen Effektes teils 9 sehr schwere Nebenwirkungen auftreten können.
Das Coronavirus, genauer SARS-CoV-2, ist wie alle Viren ein „Parasit“. Es braucht einen Wirt, um sich zu vervielfältigen. So bemächtigt sich das Virus der menschlichen Zellen und zwingt ihnen sein Vermehrungsprogramm auf. Für die Entwicklung eines Impfstoffs und auch eines Arzneimittels gegen die Krankheit COVID-19 ist es also ausschlaggebend zu wissen, wie das Virus in die Zelle eindringt und sich dort vermehrt. Im Fokus der Forscher steht häufig das sogenannte Spike-Protein – ein Eiweiß, mit dessen Hilfe das Virus in die menschliche Zelle eindringen kann. Dieses Protein verleiht dem Virus auch seinen Namen: Wie Zacken einer Krone (Krone = lat. corona) steht es von der Virushülle ab.
Folgende Ansätze befassen sich damit, wie das Immunsystem gegen das Coronavirus mobilisiert werden kann und wie sich das Spike-Protein dafür nutzen lässt. Aktuell sind in der EU fünf Impfstoffe gegen COVID-19 zugelassen, darunter zwei Vektor- und zwei mRNA-Impfstoffe sowie ein Untereinheitenimpfstoff. Weitere Impfstoffkandidaten befinden sich in der klinischen Prüfung oder im Zulassungsverfahren.
Bei diesem Ansatz wird ein harmloses Virus mit gentechnischer Hilfe als SARS-CoV-2 „verkleidet“. Das Virus, meist ein Erkältungsvirus (gehört zur Gruppe der Adenoviren), bildet auf seiner Oberfläche das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Erregers aus, ist aber nicht in der Lage, Zellen zu infizieren. Die Geimpften sollen darauf reagieren, indem ihr Immunsystem dieses Protein erkennen und in der Folge das Virus bekämpfen kann.
Studien belegen die Wirksamkeit von Vektor-Impfstoffen. Für die bislang zwei zugelassenen Vektor-Impfstoffe ist die Wahrscheinlichkeit nach einer vollständigen Impfung an COVID-19 zu erkranken, um 65 bis 80 Prozent geringer als bei ungeimpften Personen. Schwere Krankheitsverläufe, wie zum Beispiel eine Behandlung im Krankenhaus, lassen sich bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften um 95 bis 100 Prozent verhindern. Aktuelle Studien deuten ebenfalls darauf hin, dass Vektor-Impfstoffe bei neuartigen Virusvarianten schwere Krankheitsverläufe unterbinden.
Der neueste Typ von Impfstoffen sind genbasierte Vakzine. Dabei enthalten die Impfstoffe eine Kopie ausgewählter Gene des Virus. Das geniale Prinzip dahinter: Diese Impfstoffe liefern den Bauplan des Virus, sodass nach der Injektion der menschliche Organismus (nicht infektiöse) Eiweißstoffe des Virus – darunter auch Spike-Proteine – herstellt. Das Immunsystem reagiert darauf und baut einen Immunschutz auf wie bei konventionellen Impfstoffen.
Bei den genbasierten Impfstoffen produziert der Körper also den Impfstoff selbst, während bei den herkömmlichen Tod- oder Lebendimpfstoffen abgetötete oder abgeschwächte Viren bzw. Virenbestandteile gespritzt werden. Basis der neuen Impfstoffe ist vor allem RNA, eine Art Kopie der DNA, also des genetischen Materials im Zellkern. Dabei handelt es sich genauer um eine Boten-RNA (messenger RNA - mRNA), die die genetische Information aus dem Zellkern heraustransportiert, damit daraus von der Zelle Proteine hergestellt werden können. Unschlagbarer Vorteil der mRNA-Impfstoffe: Sie können sehr schnell in großen Mengen produziert werden.
Die Bundesregierung schätzte diesen Ansatz als so vielversprechend ein, dass sie sich mit etwa 300 Millionen Euro an Biotech-Unternehmen beteiligt hat. Zudem hat sie mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Forschung und Entwicklung derartiger SARS-CoV-2-Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Dabei sieht sie auch das Potenzial für mRNA-Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten oder auch für mRNA-basierte Arzneimittel (s. Antikörper, unten).
Für die Entwicklung sogenannter Untereinheitenimpfstoffe setzen Wissenschaftler unterschiedliche biotechnologische Verfahren ein. Bei diesen Impfstoffen lagern sich die Spike-Proteine spontan zusammen und bilden dann virusähnliche Partikel aus. Kombiniert man diese virusartigen Partikel mit einem Wirkverstärker (Adjuvans), lässt sich eine ausreichende und zugleich länger andauernde Schutzwirkung nach erfolgter Impfung erzielen.
Anders als bei den anderen virusbasierten Impfstoffkandidaten, erhält dieser Impfstoff keine genetischen Informationen. Untereinheitenimpfstoffe erhalten Erreger-Bestandteile, die sich weder vermehren noch eine Erkrankung auslösen können. Hersteller nutzen Untereinheitenimpfstoffe mit Adjuvantien bereits als HPV-Impfstoffe oder Impfstoffe für Gürtelrose.
Wie andere Impfstoffe auch, wird ein Corona-Impfstoff erst auf den Markt gebracht, wenn sorgfältig seine Sicherheit, Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in klinischen Studien der Phasen I, II und III im behördlichen Zulassungsprozess (präklinische und klinische Phase, Zulassungsprüfung, Auflagen der Zulassungsbehörden und Marktzulassung, Nachzulassungsbeobachtung) nachgewiesen wurde. Auch danach wird er laufend behördlich überwacht, Nebenwirkungen und Impfreaktionen werden zentral vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erfasst. Die Sicherheit bleibt, trotz Vereinfachung des Zulassungsprozesses, oberste Priorität.
Die verimpfte mRNA löst im Körper des geimpften Menschen die Bildung von Spikeproteinen aus. Mit Hilfe dieser Spikeproteine gelangt das Virus im Krankheitsfall in die menschliche Zelle, wo es sich millionenfach vermehrt. Dadurch kommt es zu Schäden an den befallenen Zellen des Menschen und es entstehen die entsprechenden Krankheitssymptome.
Bildet aber der geimpfte und gesunde Körper die Spikeproteine, ohne dass das Virus in den Körper eingedrungen ist, entwickelt er bereits im gesunden Zustand die passenden Antikörper für das lauernde Virus. Wenn dann der geimpfte Mensch vom SARS-CoV 2 befallen wird, verfügt er bereits über die richtigen Antikörper, die das Virus effektiv bekämpfen und vernichten. Der Mensch erkrankt dadurch nicht an COVID-19.
Das Ziel der aktiven Impfung ist es, die Bildung von körpereigenen Antikörpern anzuregen – im Gegensatz zur passiven Impfung, bei der bereits Antikörper einer erkrankten Person gespritzt werden, die sie selber nicht mehr bilden kann.
Die bedingte Zulassung der Europäischen Kommission für die mRNA (Boten-Ribonucleinsäure)-Impfstoffe gilt für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung der COVID-19 Erkrankung (Corona Virus Disease 2019), welche durch das SARS-CoV-2 Virus (schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus 2) verursacht wird.
Eine bedingte Markzulassung in der Europäischen Union wird durch die EU-Kommission beispielsweise für einen ungedeckten medizinischen Bedarf erteilt, wie es bei der Immunisierung von Personen zur Vorbeugung einer COVID-19-Erkrankung der Fall ist. Sie kann im Interesse der Allgemeinheit im Fall einer Pandemie oder anderen Notfallsituationen, sowohl bei einer Bedrohung der öffentlichen Gesundheit angewendet als auch bei Erkrankungen mit tödlichem Ausgang oder lebenslanger schwerer körperlicher sowie geistiger Beeinträchtigung erteilt werden. Bedingte Zulassungen sind ein Jahr lang gültig und können jährlich erneuert werden. Sie können im Zeitlauf in eine Vollzulassung mit unbegrenzter Gültigkeit überführt werden. Alle fünf in der EU und damit in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoffe haben derzeit eine bedingte Marktzulassung.
Zu den spezifischen Verpflichtungen gehören in der Regel Lieferungen von Daten durch den Inhaber der Marktzulassung aus klinischen Prüfungen und Beobachtungsstudien, die stattfinden, während der bereits zugelassene Impfstoff schon verabreicht wird. Diese Daten sollen den Zulassungsbehörden weitere Informationen zur Wirksamkeit, Nebenwirkungen und im Zusammenhang mit Notfällen der öffentlichen Gesundheit zur pharmazeutischen Qualität liefern.
Trotz der schnelleren Zulassung wird garantiert, dass die hohen EU Standards für die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eingehalten werden und somit der Nachweis eines positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses belegt ist. Das heißt, dass die frühere Verfügbarkeit des neuen Impfstoffes das Risiko noch fehlender Daten wettmacht. Weitere umfassende Daten müssen in der Regel bei bedingten Zulassungen auch nach dem Inverkehrbringen des Arzneimittels/ Impfstoffes durch das Unternehmen bzw. durch den Halter der Zulassung innerhalb eines festgelegten Zeitraumes bereitgestellt werden. Diese Forderungen nach später, innerhalb bestimmter Fristen, zu liefernden Daten geht oft über die Menge von Daten hinaus, die in „normalen“ Zulassungsverfahren gefordert werden.
Unter herkömmlichen Umständen müssen alle Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität, die einen Antrag auf Zulassung eines Arzneimittels unterstützen, zu Beginn des Zulassungsverfahrens im Rahmen eines formalen Zulassungsantrags eingereicht werden. Im nächsten Schritt werden sie begutachtet.
Die bedingte Zulassung konnte auch innerhalb einer ungewöhnlich kurzen Frist erfolgen, weil neben dem Verfahren der bedingten Zulassung das Verfahren der beschleunigten Bewertung im Rahmen eines „rolling reviews“ von der EMA eingesetzt wurde. Das heißt, viele Bewertungsprozesse, die üblicherweise nach der abgeschlossen Entwicklung eines Impfstoffes stattfinden, sind zeitlich vorgezogen worden. Sobald ein neues Datenpaket bereits während der Entwicklung des Impfstoffes z. B. in klinischen Prüfungen zur Verfügung stand, wurde dieses unverzüglich in die bereits gestartete Bewertung einbezogen. Mit diesen als "rolling review" bezeichneten Verfahren konnte somit der zeitlich aufwendige Bewertungsprozess beschleunigt ablaufen.
Nein, die Bewertung der EMA erfolgte im Rahmen der vertraulichen Zusammenarbeit mit mehreren Nicht-EU-Regulierungsbehörden (z. B. der FDA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen. Sie engagierte sich zudem in der International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), um eine globale Abstimmung sicherzustellen.
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), ist in Deutschland unter anderem für die nationale Zulassung von Impfstoffen zuständig. Das PEI veröffentlicht regelmäßig Daten aus Rückmeldungen zu unerwünschten Nebenwirkungen (Sicherheitsberichte) seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland am 27. Dezember 2020.
Sicherheitsbericht 27.12.2020 bis 31.03.2022
Das Paul-Ehrlich-Institut fasst im aktuellen Sicherheitsbericht die Meldungen über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen zusammen, die es seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland am 27.12.2020 bis zum 31.03.2022 erhalten hat.
-
Vom 27.12.2020 bis zum 31.03.2022 wurden in Deutschland insgesamt 172.062.925 Impfungen zum Schutz vor COVID-19 durchgeführt. Bei 73,3 Prozent der Impfdosen handelte es sich um Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), bei 17,1 Prozent um Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.), bei 7,4 Prozent um Vaxzevria (AstraZeneca AB), bei 2,1 Prozent um COVID-19 Vaccine Janssen (neuer Name Jcovden) und bei 0,1 Prozent um Nuvaxovid (Novavax CZ, a.s.).
-
Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt in demselben Zeitraum 296.233 Meldungen von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen.
-
Die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,7 Meldungen pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen 0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen.
-
Die Melderate nach Booster-Impfungen mit Comirnaty oder Spikevax war niedriger als nach der Grundimmunisierung.
-
Seit dem letzten Sicherheitsbericht mit Daten bis zum 31.03.2022 wurde kein neues Risikosignal identifiziert.
Das Paul-Ehrlich-Institut wird Fälle einer Myo-/Perikarditis, von Thrombosen und immunologisch-vermittelten unerwünschten Reaktionen wie Immunthrombozytopenie nach Gabe der zugelassenen Impfstoffe intensiv überwachen und weiter untersuchen.
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), ist in Deutschland unter anderem für die nationale Zulassung von Impfstoffen zuständig. Das PEI veröffentlicht regelmäßig Daten aus Rückmeldungen zu unerwünschten Nebenwirkungen (Sicherheitsberichte) seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland am 27. Dezember 2020.
Sicherheitsbericht 27.12.2020 bis 31.03.2022
Das Paul-Ehrlich-Institut fasst im aktuellen Sicherheitsbericht die Meldungen über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen zusammen, die es seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland am 27.12.2020 bis zum 31.03.2022 erhalten hat.
- Vom 27.12.2020 bis zum 31.03.2022 wurden in Deutschland insgesamt 172.062.925 Impfungen zum Schutz vor COVID-19 durchgeführt. Bei 73,3 Prozent der Impfdosen handelte es sich um Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), bei 17,1 Prozent um Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.), bei 7,4 Prozent um Vaxzevria (AstraZeneca AB), bei 2,1 Prozent um COVID-19 Vaccine Janssen (neuer Name Jcovden) und bei 0,1 Prozent um Nuvaxovid (Novavax CZ, a.s.).
- Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt in demselben Zeitraum 296.233 Meldungen von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen.
- Die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,7 Meldungen pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen 0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen.
- Die Melderate nach Booster-Impfungen mit Comirnaty oder Spikevax war niedriger als nach der Grundimmunisierung.
- Seit dem letzten Sicherheitsbericht mit Daten bis zum 31.03.2022 wurde kein neues Risikosignal identifiziert.
Das Paul-Ehrlich-Institut wird Fälle einer Myo-/Perikarditis, von Thrombosen und immunologisch-vermittelten unerwünschten Reaktionen wie Immunthrombozytopenie nach Gabe der zugelassenen Impfstoffe intensiv überwachen und weiter untersuchen.
Die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 trimmen das Immunsystem darauf auf bestimmte Oberflächenstrukturen des Coronavirus zu reagieren und es zu bekämpfen. Besonders wichtig sind dabei die sogenannten Spike-Proteine, mit denen das Virus an Zellen andockt, um in sie einzudringen. Durch Mutationen verändern sich aber auch diese Proteine, die dem durch die Impfung "geschulten" Immunsystem als Erkennungsmerkmal dienen sollen. Mittlerweile sind verschiedene Mutationen bekannt (Alpha, Delta, Omikron) die sich weltweit verbreiten.
Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die beiden zugelassenen mRNA-Impfstoffe bei einer Infektion mit der Delta-Variante eine hohe Wirksamkeit gegen einen schweren Infektionsverlauf. Die Wahrscheinlichkeit, schwer an COVID-19 zu erkranken, ist für eine vollständig geimpfte Person um 90% geringer als bei einer ungeimpften Person. Für die Alpha-Variante ist ebenfalls eine sehr gute Wirksamkeit zu beobachten.
Doch wie sieht es mit der aktuellen Omikron-Variante aus?
Erste Erkenntnisse liefert eine Studie des Vereinigten Königreiches: Die Wirksamkeit der Grundimmunisierung gegen eine symptomatische Erkrankung durch die Omikron-Variante ist im Vergleich zu Delta oder Alpha deutlich geringer und lässt mit der Zeit rapide nach. Auch die Neutralisationsfähigkeit gegenüber dieser Variante ist vermindert.
Jedoch ist eine gute Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe gegen Omikron nach einer sogenannten Booster-Impfung festgestellt worden.
Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission STIKO eine Booster-Impfung für alle grundimmunisierten Personen im Alter von >18 Jahren.
Pharmazeutische Unternehmer, die in Deutschland Arzneimittel (also auch Impfstoffe) in den Verkehr bringen, haften grundsätzlich für Entwicklungs- und Herstellungsfehler. Im Rahmen der aktuellen Entwicklung von Corona-Impfstoffen in Form eines straff vorangetriebenen Zulassungsprozesses geht es aber nicht um eine Haftungsbefreiung, sondern um eine angemessene Risikoverteilung.
Es besteht ein dringender, gesellschaftlich und politisch gewollter, Handlungsbedarf: Pharmaunternehmen sollen und müssen unter enormem Zeit- und Kostendruck wirksame, sicherere Impfstoffe entwickeln. Dies geschieht in enger Abstimmung und Koordination mit den zuständigen Behörden. Die Politik muss in dieser Situation die Verantwortung für etwaige Risiken mittragen; andernfalls kann es in kurzmöglichster Zeit keinen Covid-19-Impfstoff geben. Normalerweise werden Impfstoffe über viele Jahre, nicht selten über Jahrzehnte entwickelt.
Es wird schnellstmöglich ein System erdacht und durchgesetzt werden, in dem die Staaten weltweit ihre Bedarfe melden und Impfstoffmengen zentral zugeteilt bekommen. Diesem Ziel hat sich die Plattform COVAX unter der Führung der Impfallianz Gavi, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Forschungsallianz CEPI verschrieben (siehe Auswärtiges Amt).
Sofern der Impfstoff dann weltweit verteilt wäre, müssten die lokalen Behörden wiederum sicherstellen, dass die Impfung der Bevölkerung ordnungsgemäß (vermutlich gestuft nach Risikogruppen etc.) vorgenommen wird.
Die Lieferung bzw. der Transport von Arzneimitteln über Ländergrenzen hinweg ist auch heute schon gang und gäbe, genügend brach liegende Flugkapazitäten gibt es momentan auch, herausfordernd kann auch hier der temperaturgeführte Transport (d.h. der Transport in einem bestimmten Temperaturbereich) sein (das hängt allerdings auch vom jeweiligen Impfstoff ab).
Hier sind sowohl beteiligte Großhändler als auch die abgebenden Stellen gefragt, kurzfristig Strukturen zu schaffen oder bestehende zu erweitern, um bei Wärme und Kälte in den kommenden Monaten für eine konstante Qualität des Impfstoffes zu sorgen.
Prof. Dr. Theo Dingermann im BPI-Themendienst Innovationen:
„Bisher haben die Behörden oft wochenlang über den Unterlagen gesessen und erst nach einem Bescheid wurde die nächste Phase eingeleitet. Jetzt spart man unglaublich viel Zeit, indem bestimmte Schritte parallel ablaufen, und nicht nacheinander. Während eine Studienphase noch läuft, stimmt man sich schon über die nächste Phase ab. Zudem werden beispielsweise schon in frühen Studienphasen mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeschlossen oder in einer Studie gleich mehrere neue Arzneimittel-Kandidaten gleichzeitig getestet. Sicherlich lernen die Zulassungsbehörden dadurch massiv dazu. Noch relevanter ist aber der Schub, den neue Technologien erfahren, die es bisher noch nicht auf dem Markt gibt. Ich denke da vor allem an die RNA-Impfung. Einen solchen Impfstoff in großen Mengen zu produzieren, ist eine Sache von Wochen statt bisher Monaten und zudem vergleichsweise günstig. Und sollte das Coronavirus mutieren, hätten wir auch dann innerhalb von wenigen Wochen einen neuen Impfstoff auf dem Markt.“
Im Bereich der Impfstoffe sind Verzögerungen bei anderen Projekten nicht ausgeschlossen. Die gesamte Branche wird aber nicht in ihrer Innovationsfähigkeit gebremst werden, denn die Impfstoffsparte ist hochspezialisiert und macht nur einen kleinen Teil aus.
Der Preis wird wie üblich zwischen den Herstellern und den Vertretern der Gesundheitssysteme verhandelt. Nach Einschätzung des Experten Prof. Dr. Dieter Cassel „sind momentan keine überzogenen Preisaufrufe feststellbar“. Er rechnet mit einem Preiswettbewerb sobald es mehrere austauschbare Impfstoffe gibt. Bei ca. fünf Milliarden benötigten Dosen käme es zu einer Degression der Stückkosten einer einzelnen Impfdosis. Einen einheitlichen Impfpreis werde es aber nicht geben, da Preiskomponenten wie etwa Apotheken- und Großhandelsspannen, Arzthonorare und Steuern von Land zu Land variierten. Viele Hersteller haben aber bereits angekündigt, die Impfstoffe zum Selbstkostenpreis abzugeben.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt COVID-19-Impfung für alle Personen ab 18 Jahren sowie für Kinder und Jugendliche im Alter von 12-17 Jahren als Indikationsimpfung, die aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf haben.
Nach sorgfältiger Analyse der verfügbaren Daten empfiehlt die Ständige Impfkommission außerdem für Kinder im Alter von 5-11 Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen aufgrund des erhöhten Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf eine Grundimmunisierung.
Auch für Schwangere, ab dem 2. Trimenon, und Stillende ist eine Impfung empfohlen.
Ob eine Grippeimpfung medizinisch sinnvoll und notwendig ist, entscheidet immer der behandelnde Arzt im individuellen Patientenfall. Generell empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) aktuell, dass sich „insbesondere ältere Menschen ab 60 Jahren/hochaltrige Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen“ gegen Grippe impfen lassen sollten. Das Robert-Koch-Institut betont: „Gerade im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen essentiell, um in der Grippewelle schwere Influenza-Verläufe zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern (u.a. bei Intensivbetten, Beatmungsplätzen) zu vermeiden.“ (siehe RKI)